Hol dir mit Blinkist die besten Erkenntnisse aus mehr als 7.000 Sachbüchern und Podcasts. In 15 Minuten lesen oder anhören!
Jetzt kostenlos testen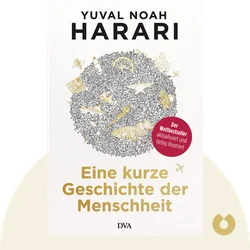
Blink 3 von 12 - Eine kurze Geschichte der Menschheit
von Yuval Noah Harari

Eine Kritik der dissonanten Herrschaft
Der Sound der Macht ist ein spannender Thriller, der die dunklen Machenschaften in der Musikindustrie aufdeckt. In einer Welt voller Intrigen und Verrat gerät eine aufstrebende Sängerin in Lebensgefahr. Wird sie die Wahrheit ans Licht bringen können?
Wenn ein Sack Reis in China umfällt, interessiert das niemanden, weiß der Volksmund. Doch das geflügelte Wort tut dem weißen Korn unrecht. Ein einzelner Sack spielt vielleicht keine große Rolle, aber fällt die gesamte Reisernte in China schlecht aus, betrifft uns das durchaus. Denn es hat Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und Politik, die Exportgeschäfte, die Reispreise an den Börsen und damit auch auf die deutsche Wirtschaft und jeden Einzelnen von uns.
Die Globalisierung lässt die Auswirkungen auch weit entfernter Ereignisse ganz nah rücken. Über Zeitungen, Blogs und Social Media gelangen Nachrichten aus den entlegensten Winkeln der Welt in die deutschen Wohnzimmer. Das prägt unsere Haltung und den gesellschaftlichen Diskurs und kann Politiker unter enormen Zugzwang setzen. Ein Beispiel: der Atomreaktorunfall in Fukushima.
Jahrelang hatte sich die CDU gegen die Schließung von Atomkraftwerken eingesetzt. Nach dem Reaktorunfall beschloss Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 über Nacht, die Laufzeitverlängerungen der deutschen Atomreaktoren vorzeitig zu beenden, ohne vorherige Abstimmung in ihrer Partei oder dem Bundestag. Sie begründete ihre Entscheidung mit den „nicht beherrschbaren Risiken“ der Kernenergie. Ein Argument, das normalerweise eher Grünen-Politiker vortragen.
Fukushima ist zwar ein Extrembeispiel, zeigt aber, dass sich die Haltungen von Parteien manchmal drastisch und plötzlich ändern können. Wähler müssen regelmäßig die Nachrichten verfolgen, wenn sie auf dem Laufenden bleiben und wissen wollen, welche Partei gerade welches Programm vertritt und inwieweit sie es auch umsetzt. Denn häufig lösen Parteien ihre Wahlversprechen nicht ein. Das liegt weniger an der Böswilligkeit von Politikern als vielmehr am demokratischen System.
Parteien müssen Koalitionen bilden und Kompromisse eingehen, die nicht immer mit den einstigen Versprechen übereinstimmen. Dabei können die Konturen der einzelnen Parteien verloren gehen. CDU und SPD haben sich in den Jahren der Großen Koalition so stark angenähert, dass es mitunter schwerfällt, das Sozialdemokratische bzw. Konservative in den Parteiprogrammen zu erkennen.
So profillos die Parteien geworden sind, so schwammig ist auch die Sprache der Politiker geworden. Den Wähler lässt das in Unsicherheit und Unklarheit zurück.



Die Sprache von Politikern formt das gesellschaftliche Klima eines Landes. Wenn Politiker z.B. von Alternativlosigkeit reden, beschädigt das die Debattenkultur und damit die Demokratie. Die Blinks zu Astrid Sévilles Der Sound der Macht (2018) erklären, wie die Sprache von Politikern das Selbstverständnis einer Gesellschaft prägt und wie sie sogar dem Populismus in die Karten spielen kann.
„Sobald jemand die Alternativlosigkeit seiner Politik behauptet, ist etwas faul.

Ich bin begeistert. Ich liebe Bücher aber durch zwei kleine Kinder komme ich einfach nicht zum Lesen. Und ja, viele Bücher haben viel bla bla und die Quintessenz ist eigentlich ein Bruchteil.
Genau dafür ist Blinkist total genial! Es wird auf das Wesentliche reduziert, die Blinks sind gut verständlich, gut zusammengefasst und auch hörbar! Das ist super. 80 Euro für ein ganzes Jahr klingt viel, aber dafür unbegrenzt Zugriff auf 3000 Bücher. Und dieses Wissen und die Zeitersparnis ist unbezahlbar.
Extrem empfehlenswert. Statt sinnlos im Facebook zu scrollen höre ich jetzt täglich zwischen 3-4 "Bücher". Bei manchen wird schnelle klar, dass der Kauf unnötig ist, da schon das wichtigste zusammen gefasst wurde..bei anderen macht es Lust doch das Buch selbständig zu lesen. Wirklich toll
Einer der besten, bequemsten und sinnvollsten Apps die auf ein Handy gehören. Jeden morgen 15-20 Minuten für die eigene Weiterbildung/Entwicklung oder Wissen.
Viele tolle Bücher, auf deren Kernaussagen reduziert- präzise und ansprechend zusammengefasst. Endlich habe ich das Gefühl, Zeit für Bücher zu finden, für die ich sonst keine Zeit habe.
Hol dir mit Blinkist die besten Erkenntnisse aus mehr als 7.000 Sachbüchern und Podcasts. In 15 Minuten lesen oder anhören!
Jetzt kostenlos testen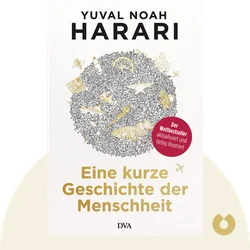
Blink 3 von 12 - Eine kurze Geschichte der Menschheit
von Yuval Noah Harari